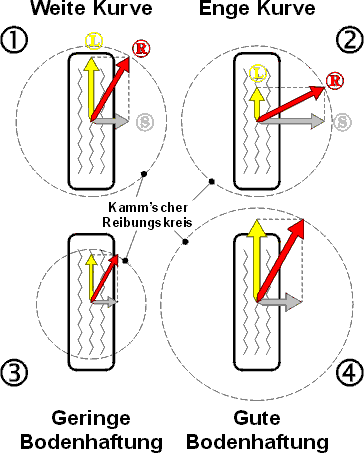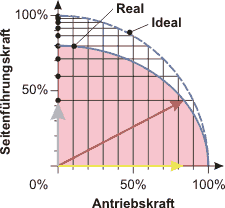Kräfte am Rad
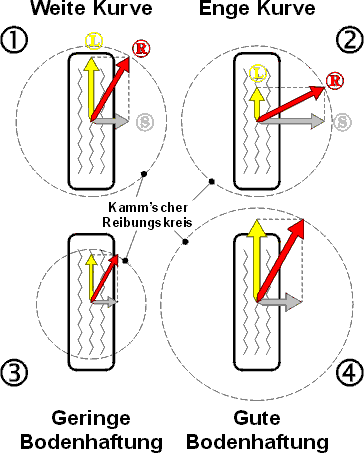
Wichtig für die Kraftübertragung auf die Straße sind die
Reibungskräfte auf der Fahrbahn. Die gesamte Vermittlung dieser
Haftungskräfte erfolgt über die Reifen.
Für die Betrachtung der Reifenhaftung gibt es das vereinfachte Modell der
Coulombschen Reibung, welches für die Darstellung der Grundprobleme reicht,
obwohl es nicht ganz sachgerecht ist - Eine genaue, gute und ausführliche
Beschreibung der Reifenhaftung an sich habe ich auf der Motorsport-Seite von
Bridgestone gefunden.
Hier soll uns Folgendes genügen: Die Kraft ist kaum von der Reifengröße abhängig,
sie hängt aber vom Gewicht und den Reibungsverhältnissen zwischen Reifen und Straße
ab - wie man es von der Coulombschen Reibung her kennt. Reifen, die für höhere
Geschwindigkeitsklassen gebaut sind, haben in der Regel auch weichere
Gummimischungen und sollten besser auf der Straße haften.
Ein Reifen muss im Fahrbetrieb zwei Arten von Kräften übertragen:
- Längskräfte, die in Lauf- bzw. Umfangsrichtung wirken und vom Antrieb
oder Bremsen verursacht werden
- Seitenkräfte, die quer zur Fahrtrichtung wirken und bei Kurvenfahrt
auftreten.
Wichtig ist, dass Reifen nur ein bestimmtes Kraftschlusspotential haben.
Der Kamm’sche Reibungskreis drückt das aus, was aus der Coulombschen
Reibung und der verktoriellen Addition der maximal übertragbaren
Haftreibungskraft folgt.
Die Grafik zeigt, wie Seitenkräfte, Umfangskräfte und
der Kamm’sche Reibungskreis zusammenhängen:
- Der rote Pfeil (R) zeigt die maximal übertragbare Kraft, sie hängt
von der Bodenhaftung ab.
- Der gelbe Pfeil zeigt die Längs- (L) oder Umfangskraft, diese hängt davon
ab, wie stark gebremst oder beschleunigt wird. In physikalischem Sinne ist auch das Fahren
mit konstanter Geschwindigkeit ein Beschleunigen, da ständige Antriebskräfte vom
Rad auf die Fahrbahn wirken, um die Verluste durch den Luftwiderstand (und andere
Kräfte) auszugleichen.
- Der graue Pfeil zeigt die Seitenführungskraft (S)
- Der Durchmesser des Kreises (Kamm’scher Reibungskreis) ist ein Maß
für die maximale Bodenhaftung, auch Kraftschlusspotential genannt.
Die einzelnen Bilder bedeuten dabei folgendes:
- Dieses Bild zeigt große Längskräfte in einer weiten Kurve. Wenn die Kurve
enger wird ...
- ... wachsen die Seitenkräfte und für Antriebskräfte bleibt weniger
Potential, das Fahrzeug kann also nicht mehr so stark beschleunigt oder
gebremst werden.
- Hier wird die Bodenhaftung geringer (z. B. auf nasser Straße), das beschränkt
sowohl die Möglichkeit, enge Kurven zu fahren, als auch die maximal möglichen
Antriebs- und Bremskräfte.
- Hier wird die Bodenhaftung größer (z.B. warmer Asphalt in der Mittagssonne),
deshalb können Kuven schneller gefahren werden und das Fahrzeug läßt sich
stärker bremsen. Durchdrehende Reifen werden unwahrscheinlicher.
Umfangskraft und Seitenführungskraft begrenzen sich gegenseitig. Wenn der Fahrer
beim Gasgeben in der Kurve diese Zusammenhänge nicht beachtet, wird der rote
Pfeil so lang, dass er den Kamm’schen Reibungskreis verläßt. Auf der Straße
heißt das, dass das Rad die Bodenhaftung verliert, durchdreht, blockiert oder
das ganze Fahreug zum Ausbrechen (Hinterräder ohne Haftung) bringt bzw. das Fahrzeug
geradeaus weiter rutschen läßt (Vorderräder ohne Haftung).
Das Kraftschlusspotential kann durch verschiedene Maßnahmen erhöht werden:
Ein höheres Fahrzeuggewicht erhöht das Kraftschlusspotential. Das Fahrzeuggewicht erhöht
aber auch den Beschleunigungswiderstand und fordert bei Kurvenfahrt mehr Seitenkräfte, so
dass dadurch keine Verbesserungen bei der maximalen Kurvengeschwindigkeit möglich sind.
Die Bremswege werden auch nicht kürzer, eher länger (liegt eher an der Bremsanlage).
Und das Beschleunigungsvermögen läßt nach, da die unveränderte Motorleistung mehr Masse
in Bewegung setzen muss.
Geometrische Interpretation: Der Durchmesser des Kammschen Kreises vergrößert sich, aber
die Kraftvektoren wachsen im gleichen Verhältnis mit.
Im Rennsport sorgen Spoiler für vergrößerten Abtrieb. Da die Effekte, die bei größerer
Masse auftreten, hier fehlen, kann man eine höhere Kurvengeschwindigkeit fahren und die Räder
können mehr Antriebs- und Bremskräfte übertragen.
Geometrische Interpretation: Der Durchmesser des Kammschen Kreises vergrößert sich.
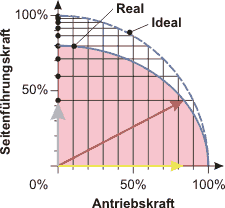
In der Praxis erweist sich die Reifenhaftung nicht als einfache Coulombsche
Reibung, daher ist der Kammsche Reibungskreis auch eher eine Ellipse, wie
das Bild rechts zeigt. Danach kann ein Reifen höhere Umfangskräfte als Seitenkräfte
übertragen.
Bei idealer Coulombscher Reibung würde der gestrichelte blaue Viertelkreis gelten
und sich bei 40% Seitenführungskraft noch 92% der maximal möglichen Umfangskraft
übertragen lassen, was sich nach der Formel 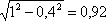 berechnen ließe.
berechnen ließe.
Tatsächlich ist das Kraftschlusspotential aber niedriger, siehe Bild.
Man erkennt, dass bei maximaler Kurvengrenzgeschwindigkeit (100 %
Seitenführungskraft) schon eine kleine Verringerung der Seitenkräfte (etwas
größeren Kurvenradius fahren) eine erhebliche Steigerung der Umfangsskräfte
ermöglicht.
Die Aufstandsfläche des Reifens
Oft hört man, dass ein Lkw nur auf der Fläche eines Zehn-Euro-Scheines steht. Stimmt das?
Nun, physikalisch gesehen ist diese Aufstandsfläche mal dem Reifen-Innendruck gleich der äußeren
Kraft, die der Reifen auf der Straße abstützt.
Der folgende kleine JavaScript-Rechner berechnet die Kontaktfläche zwischen Reifen und
Fahrbahn. Der Wert ist als ungefähre Fläche zu verstehen, in der Praxis muss man berücksichtigen,
dass der Reifen weder elastisch noch so dünn wie eine Folie ist:
|
 |
|
| A |
Aufstandsfläche je Rad in [m2] |
| mAchse |
Achslast in [kg] |
| g |
Erdbeschleunigung, g=9,81 m/s2 |
| pRad |
Reifenfülldruck eines Reifens an der Achse in [N/m²] |
Bei einem vollgeladenen Golf mit 890 kg Vorderachslast und 2,5 bar
Reifenfülldruck an der Vorderachse ergibt das also (mindestens) 170 cm2
Aufstandsfläche je Rad oder etwa einen 10 € Schein.
![]() berechnen ließe.
berechnen ließe.